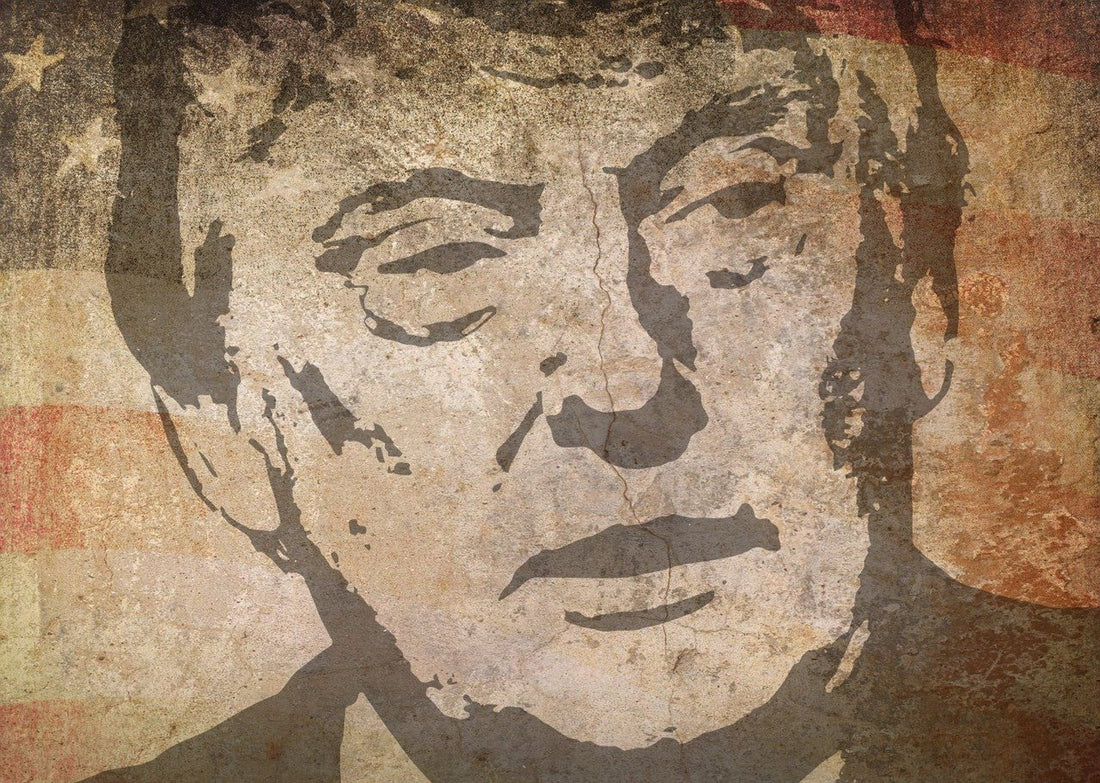
Neue US-Zollabkommen mit Japan und den Philippinen: Handelsöffnung oder politische Einbahnstraße?
Share
In der vergangenen Woche hat die US-Regierung unter Donald Trump gleich zwei bedeutende bilaterale Handelsabkommen mit Asien-Partnern unterzeichnet: mit Japan und den Philippinen. Auf den ersten Blick scheinen die Deals den Freihandel zu fördern – niedrigere Zölle, neue Investitionspakete, wachsender Austausch von Waren und Dienstleistungen. Doch bei genauerem Hinsehen offenbaren sich politische Machtspiele, wirtschaftliche Ungleichgewichte und strategisch motivierte Bedingungen, die nicht allen Beteiligten langfristig zugutekommen dürften.
Der Deal mit Japan: Erleichterung für die Börse, Kopfschmerzen für US-Hersteller
Der neue Zollvertrag zwischen den USA und Japan sieht vor, dass amerikanische Importzölle auf japanische Industrie- und Automobilgüter von bislang 25 % auf 15 % gesenkt werden. Damit erhalten japanische Hersteller einen deutlichen Vorteil auf dem US-Markt – besonders in einem Wahljahr, in dem Trump wirtschaftspolitische Erfolge präsentieren will. Zeitgleich kündigte Japan an, über 550 Milliarden US-Dollar in US-Technologieprojekte zu investieren – vor allem in den Bereichen Halbleiter, Pharmaindustrie und erneuerbare Energien.
Finanzmärkte reagierten sofort positiv: Der japanische Aktienindex Nikkei legte kräftig zu, Autoaktien wie Toyota und Honda profitierten direkt. Doch während Investoren jubelten, äußerten sich zahlreiche US-Automobilhersteller kritisch. Vertreter von Ford, General Motors und Stellantis warnten, dass der Deal die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte untergrabe. Sie müssen nach wie vor höhere Kosten für Stahl, Aluminium und Teile tragen – was japanischen Unternehmen einen strukturellen Preisvorteil verschafft.
Gewerkschaften wie die UAW (United Auto Workers) gingen sogar noch weiter und sprachen von einem "Race to the Bottom", also einem absichtlichen Unterbieten von Standards zugunsten billigerer Importe. Besonders kritisch: Trotz des Deals bleiben strukturelle Hürden für US-Fahrzeuge auf dem japanischen Markt bestehen. Amerikanische Hersteller erreichen dort seit Jahren kaum nennenswerte Marktanteile – der Deal wird daran voraussichtlich wenig ändern.
Die Philippinen: Politisches Entgegenkommen für minimale Erleichterungen
Nur einen Tag zuvor hatte Trump bereits ein weiteres Handelsabkommen mit den Philippinen verkündet. Auf dem Papier wurde ein geplanter US-Zollsatz von 20 % auf philippinische Exportprodukte auf 19 % gesenkt – eine rein kosmetische Veränderung, die vom Weißen Haus jedoch als bedeutender Durchbruch gefeiert wurde. Im Gegenzug verpflichteten sich die Philippinen, US-Waren wie Saatgut, Medikamente und Fahrzeuge künftig vollständig zollfrei zu importieren. Hinzu kamen Versprechen über erweiterte militärische Zusammenarbeit und US-Investitionen in Infrastrukturprojekte auf den Inseln.
In den Philippinen wurde der Deal gemischt aufgenommen. Einerseits sieht man in der Partnerschaft mit den USA einen Schutz vor wachsendem chinesischen Druck im Südchinesischen Meer. Andererseits befürchten viele Wirtschaftsexperten, dass das Land in eine neue Form wirtschaftlicher Abhängigkeit gerät. Die Zollsenkung um einen einzigen Prozentpunkt dürfte den philippinischen Exporteuren kaum spürbare Vorteile bringen – während die USA ihre wirtschaftliche Präsenz im Land deutlich ausbauen.
Brisant ist auch, dass kein vollständiger Vertragstext veröffentlicht wurde. Kritiker sprechen von Intransparenz und vermuten, dass das Abkommen vor allem auf geopolitische Loyalität abzielt – mit Handel als Druckmittel.
Ein strategisches Muster
Beide Abkommen folgen einem gemeinsamen Muster: Die USA sichern sich über wirtschaftliche Zugeständnisse politischen Einfluss. Im Fall Japans geschieht dies über Investitionen und Marktöffnung; im Fall der Philippinen über militärische Kooperation und Handelsvorteile. Auffällig ist, dass beide Partnerländer – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen – wenig eigene Gestaltungsmacht hatten. Japan agiert aus einer Position wirtschaftlicher Stärke, hat aber hohe Erwartungen zu erfüllen. Die Philippinen hingegen geraten durch den Deal stärker in ein US-orientiertes Lager, ohne wesentliche Handelsvorteile zu erhalten.
Für Donald Trump sind die Abkommen in jedem Fall ein politischer Gewinn. Er kann sie als Beweis dafür präsentieren, dass seine "America First"-Strategie weiterhin Wirkung zeigt – mit Investitionen, Jobs und Handelsvorteilen für die USA. Dabei bleibt offen, ob diese Effekte tatsächlich flächendeckend eintreten – oder ob einzelne Sektoren wie die US-Autoindustrie strukturelle Nachteile erleiden.
Ausblick: Wer folgt – und zu welchem Preis?
Die jüngsten Deals senden ein deutliches Signal in die Region: Die USA bevorzugen strategische Einzelabkommen mit ausgesuchten Partnern, statt auf multilaterale Freihandelsstrukturen zu setzen. Für Länder wie Vietnam, Thailand oder Indonesien stellt sich damit die Frage, ob sie ebenfalls versuchen sollten, bilaterale Deals mit den USA auszuhandeln – und wenn ja, unter welchen Bedingungen.
Klar ist: Die Machtverhältnisse sind asymmetrisch. Während Washington Bedingungen diktiert, müssen kleinere Staaten Zugeständnisse machen – oft auf Kosten ihrer Souveränität oder innenpolitischen Stabilität. Gleichzeitig wächst der Druck, sich zwischen den großen Blöcken – USA und China – wirtschaftlich zu positionieren.
Fazit
Die neuen US-Zollabkommen mit Japan und den Philippinen sind weniger Ausdruck globaler Handelsliberalisierung als Teil einer langfristigen Strategie zur wirtschaftlichen und politischen Machtsicherung. Sie bringen Vorteile – vor allem für die USA – und bieten den Partnern begrenzte Chancen unter klaren Bedingungen. Ob diese Deals langfristig stabil und fair bleiben, wird davon abhängen, wie souverän und strategisch die betroffenen Länder ihre Interessen vertreten können.
